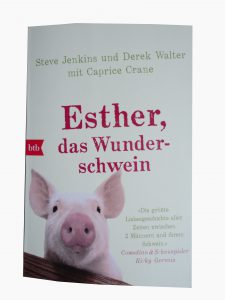Das bittere Spektakel mit Meng Meng und Jiao Qing
Am 24. Juni erhielt der Berliner Zoo zwei Pandabären aus China: Meng Meng (Träumchen) und Jiao Qing (Schätzchen). „Empfangen“ wurden diese am Flughafen von Berlins regierendem Bürgermeister und dem chinesische Botschafter Shi Mingde. Während die in einer Transportbox und hinter Plexiglas gehaltenen Bären nicht wussten, was mit ihnen geschieht, sprach Chinas Botschafter „von einem guten Tag für die deutsch-chinesischen Beziehungen.“
Der Berliner Zoo ist nun für fünfzehn Jahre in Besitz von zwei Pandabären. Zwei lebendige Leihgaben, die die Bundeskanzlerin und Chinas Staatspräsident Xi Jinping am fünften Juli in einem Staatsakt persönlich willkommen hießen, begleitet von großem Applaus. Die Betonung lag auf der chinesisch-deutschen „Zusammenarbeit zum Schutz der Großen Pandabären […]“. Die zukünftigen Zoobesucher freuen sich derweilen auf die Besichtigung der neu eingetroffenen Pandas.
Geht es hier tatsächlich um Tierliebe und Artenschutz?
Die Tierärztin Kati Löffler arbeitete in einer Aufzuchtstation im chinesischen Chengdu, von der auch die beiden Pandabären Meng Meng und Jiao Qing stammen. In einem Interview mit der „Welt“ erklärt sie das Vorgehen in dieser Station. Während in freier Wildbahn Pandaweibchen alle drei oder vier Jahre ein bis zwei Junge zur Welt bringen, bekommen sie in Chengdu jedes Jahr Zuwachs. Um dies zu erreichen, werden den Pandamüttern ihre Jungen sehr früh weggenommen, damit diese schnellstmöglich wieder empfängnisbereit sind und ein neues Junges „produzieren“ können. Eigentlich geschieht hier nichts anderes, als mit den „Nutztieren“ in unserer Gesellschaft: Die Pandaweibchen fungieren als Gebärmaschinen, sich als Mutter auszuüben, bleibt ihnen verwehrt. Die Aufzuchtstationen dienen als Geburtsfabriken, in denen die Jungen zwischen Juni und September das Licht der Welt erblicken und im Dezember ihren Müttern letztendlich weggenommen werden. Laut der Tierärztin aufgrund der Überzeugung, Pandamütter seien nicht in der Lage ihre Babys zu erziehen. Eine absurde Denkweise, denn in natürlicher Umgebung bleiben junge Pandas mindestens anderthalb Jahre bei ihrer Mutter und lernen in dieser Zeit von ihr, wie sie mit anderen Bären, anderen Spezies, schlussendlich mit der Umwelt umgehen. In der Aufzuchtstation wird dieses Mutter-Kind-Verhältnis gleich zu Beginn gestört: Menschen behüten die Kinder, therapieren, füttern sie und stecken sie in Brutkästen. Die Pfleger verkleiden sich zudem mit Pandakostümen und schmieren sich mit Pandakot ein, um das Aussehen und den Geruch der Pandas zu imitieren. Als ob der Mensch die natürliche Mutter von Kindern einer anderen Spezies komplett ersetzen könnte. Laut Kati Löffler wissen die Pandas sogar ganz genau, dass sich dahinter Menschen verbergen.
Das Ergebnis sind kranke, verhaltensgestörte Tiere, die weder psychisch noch physisch in der Lage sind in Freiheit zu leben. Gezüchtet für ein Leben in Gefangenschaft. Ein gestresstes Leben hinter Glasscheiben oder Gitter, um von Menschen „begafft“ zu werden. Ein Leben, das sie noch kränker macht und mitnichten zu einer Besserung ihres Zustandes führt.
Die Zoolüge am Beispiel der Pandas
Dies bestätigte sich unverkennbar an Meng Meng, nur zweieinhalb Wochen nach der Ankunft der Pandas im Zoo Berlin. So berichteten Medien wie die Berliner Tageszeitung „B.Z.“ von einer großen Sorge um das Pandaweibchen, die sich in ihrem Glaspavillon vorwiegend rückwärts bewegt. An der Besucherglasfront entlang, die gleichen Wege stets beibehaltend, läuft sie eine Tatze hinter die andere führend mit dem Hinterteil vorneweg. Von allen gesehen, ließ sich dieses Verhalten nicht länger verleugnen – auch nicht von den Betreibern des Zoos.
Doch während sich Berichterstattungen unter Hinzunahme von Meinungen von Tierschützern häuften, die das Verhalten von Meng Meng als eine klare Verhaltensstörung, eine Stereotypie (bei Meng Meng eine Lauf-Kopfwipp-Stereotypie) bezeichnen, schlugen die Betreiber des Zoos einen anderen Weg ein. Auf der Homepage des Zoos stellen sie dieses Verhalten abmildernd als „Meng Mengs Marotte“ dar. Dabei handelt es sich hierbei nicht um eine schrullige Eigenart, sondern um eine psychische Störung, unter der die Bärin leidet. Einer psychischen Störung widergespiegelt in einem sich wiederholenden, gleichbleibenden und artfremden Verhaltensmuster, das bei unterschiedlichen Tieren in Zoogefangenschaft auftaucht.
So zeigte auch die Mutter von Eisbär Knut eine ähnliche Stereotypie: Tosca ging auf einer Felsenblattform immer ein oder zwei Schritte nach vorn und zurück, wobei sie mit dem Kopf hin und her wippte.
„Stereotypien bei in Gefangenschaft gehaltenen Tieren ist ein Symptom für schlechtes Wohlergehen und Wohlbefinden und weist darauf hin, dass das Tier psychisch und/oder physisch leidet .“
Solange diese Lebewesen solch einem Stress ausgesetzt sind, wird sich nichts verbessern. Ganz im Gegenteil, Verhaltensstörungen können sich dauerhaft manifestieren.
Das Herunterspielen von einem schweren Leiden auf „Meng Mengs Marotte“ zeigt einerseits, wie der Zoo die Belange der gefangenen Tiere eben nicht als oberste Priorität sieht und andererseits zusätzlich versucht, die Öffentlichkeit zu beschwichtigen. Schließlich sorgten Pandas in manchen Zoos für eine doppelte Besucherzahl. So erwies sich die Pandaanlage im Berliner Zoo an ihrem ersten regulären Öffnungstag wie erwartet als Anziehungspunkt für Besucher – fast 10 000 sollen es bis 16 Uhr gewesen sein. Nach dem Tod von Eisbär Knut baut der Zoo nun auf seine neue „Attraktion“ mit der zusätzlichen „Marotte“ Meng Mengs um noch mehr Besucher anzulocken, die sich dann (unwissentlich) an Meng Mengs furchtbarem Leiden ergötzen.
Um Tierliebe kann es hier nicht gehen. Geht es auch nicht. Hier geht es um Kommerz.
Und Geschäft ist Geschäft, auch wenn es manch einer „Freundschaftsbekundung“ nennt. Meng Meng und Jiao Qing sind lebendige Leihgaben. Sie werden als Leasingobjekte 15 Jahre lang im Zoo Berlin eingesperrt bleiben. Die Leihgebühr beträgt 920 000 Euro pro Jahr. Das ist der Deal mit China. Und der Zoodirektor „ist sich sicher“, wie in der „taz“ zitiert, dass es trotz dieser Summen kein Verlustgeschäft wird.
Ursprünglich war das Geld, das an China fließt, für Schutzprojekte bestimmt. Doch laut Kati Löffler weiß eigentlich niemand so richtig, wie viel davon bei den Pandas wirklich ankommt. Ein Teil des Geldes fließe „nun in die Pandaproduktionsstätten.“ Klingt logisch, denn je mehr Pandas es an andere Zoos zu verleihen gibt, desto mehr Geld wird verdient. China hat etwas davon, die Zoos haben etwas davon, es ist quasi eine Win-win-Situation. Nur für die Pandas nicht.
Der Panda als Symbol für erfolgreiche Artenschutzbemühungen?
Da reicht es auch nicht, wenn der Direktor des Zoos den Großen Panda als Symbol für erfolgreiche Artenschutzbemühungen sieht. Ein richtiger Artenschutz wird nicht möglich sein, solange der Große Pandabär nicht vor Wilderern beschützt wird, die mit seinem Fell auf den Schwarzmärkten in Fernost hohe Preise erzielen. Ein richtiger Artenschutz wird schon gar nicht möglich sein, solange die Zerstörung des natürlichen Lebensraumes der Pandas fortschreitet: Denn die Nachfrage nach Land- und Naturressourcen nimmt aufgrund der wachsenden chinesischen Bevölkerung stetig zu, dazu kommt die Verseuchung von Böden, Flüssen und Seen aufgrund der Plünderung von Rohstoffen durch Baukonzerne.
Die Zerstörung der Heimat der Pandas wiederum als Argument zu nehmen, um diese dafür in künstlichen Aufzuchtstationen aufzuziehen, ist mehr als fragwürdig. Denn je intensiver diese Zucht betrieben wird, desto weniger, so Löffler, wird unternommen, um den natürlichen Lebensraum der Pandas zu schützen.
„How can we expect wild animals to survive if we give them nowhere in the wild to live?„ (2)
Dazu kommen die schlechten Prognosen für eine erfolgreiche Nachzucht und Wiederauswilderung der Pandas. Zum einen, da deren Lebensräume zerstört werden. Zum anderen funktioniert es nicht einen Panda in einer künstlichen, engen Umwelt (Löffler vergleicht es mit einem „Dixiklo“) großzuziehen und nach jahrelanger „Aufbewahrung“ in eine Welt zu entlassen, mit der er noch nie in Berührung gekommen ist. Mehrmals wurde es in China versucht, jedes Mal sind die Bären dabei gestorben oder wurden von Artgenossen verletzt. Die Bären aus der Aufzuchtstation haben es nicht gelernt, mit ihren wilden Artgenossen zu kommunizieren. Sie haben es auch nicht gelernt sich in einer natürlichen Umgebung in Acht zu nehmen. Sie kennen das alles nicht und sind somit in ihrem natürlichen Lebensraum nicht überlebensfähig.
Selbst zur Pandazucht für die „Erhöhung und Bewahrung der genetischen Vielfalt in der Gesamtpopulation der in Gefangenschaft gehaltenen Pandas“ trägt der deutsch-chinesische Deal mit den Pandas im Zoo Berlin nicht bei. Aus Recherchen der Tierrechtsorganisation „EndZOO Deutschland e.V.“ geht hervor, dass beide Pandas nicht besonders „wertvoll“ für die weltweite Zucht sind. Zum einen weisen ihre Stammbäume einen gemeinsamen nahen Verwandten vor, sodass bei einer zukünftigen Verpaarung eine Inzucht vorliegen würde. Aber genau die Inzuchtvermeidung ist einer der obersten Prioritäten des chinesischen Zooverbandes (CAZG) im aktuellen „Panda-Zucht- und Managementplan“ für 2017. Zum anderen sind die Gene der beiden zu oft in der gesamten Pandabevölkerung in Gefangenschaft vertreten und wurden daher zur Zucht erst gar nicht empfohlen. Außerdem sind die Haltungs- und Zuchtmöglichkeiten in den Zoos weltweit begrenzt, ja, sogar ausgeschöpft. Offiziell wird schon eine „Verlangsamung des Bevölkerungswachstums“ in der Zucht verlangt.
Fazit? Meng Meng und Jiao Qing können demnach weder aufgrund von Tierliebe noch aufgrund der Arterhaltung, geschweige denn der „Rettung“ vom Aussterben bedrohter Pandas im Zoo Berlin gelandet sein. Sie sind aus kommerziellen Beweggründen hier – und um, wie alle anderen Zootiere auch, unzählige Zoobesucher zu erfreuen, indem sie ihre Bedürfnisse nach Unterhaltung befriedigen.
Sie sind ein Beispiel für die Arroganz mancher Menschen, sich nichtmenschlicher Tiere einfach zu bedienen, und zwar mit dem Recht, das Menschen sich einfach selbst zugesprochen haben. Nur weil sie nicht der Spezies Mensch angehören, betrachtet mensch diese als sachenähnliche Ware und Ausstellungsobjekte und, im Falle Meng Mengs und Jiao Qings, als Instrument zur politischen Selbstdarstellung.
Statt ernsthaft politisch gewollt Geld in ihren und in den Schutz ihres natürlichen Lebensraumes zu investieren, zerstören Menschen Letzteres, sperren die Tiere auf Kosten ihres Wohlergehens ein, treiben sie gar in den Wahnsinn und nehmen ihnen das ihnen eigene Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit. Dies kann mensch nicht ernsthaft Schutz nennen. Dies bedeutet nichts anderes als lebenslange Gefangenschaft, in der die nicht-menschlichen Tiere die Inhaftierten sind.
Weitere Quellen:
(1) Swaisgoog & Shepherdson/ 2005, Wechsler/ 1991 in: Paul Horsman for the Zoo Check Charitable Trust (now the Born Free Foundation), 1986 in “Captive polar bears in the UK and Ireland”
(2) Anthony Douglas Williams
Fotos: Pixabay